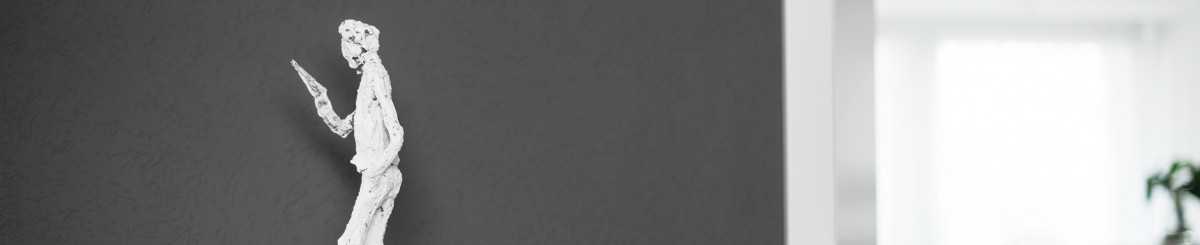20. September 2025
Erneuerungen und Änderungen am Mietobjekt
In der mietrechtlichen Praxis stellt sich regelmässig die Frage, unter welchen Voraussetzungen bauliche Erneuerungen oder Änderungen an der Mietsache zulässig sind – sei es durch den Vermieter oder durch den Mieter. Art. 260 und 260a OR enthalten hierzu grundlegende Bestimmungen, die im Folgenden erläutert werden.
Gemäss Art. 260 OR ist der Vermieter grundsätzlich berechtigt, bauliche Erneuerungen oder Änderungen an der Mietsache vorzunehmen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Massnahmen für den Mieter zumutbar sind und das Mietverhältnis zum Zeitpunkt der geplanten Arbeiten nicht gekündigt wurde. Während der Durchführung der Arbeiten hat der Vermieter die Interessen des Mieters angemessen zu berücksichtigen. Allfällige Ansprüche des Mieters auf Mietzinsherabsetzung (Art. 259d OR) oder Schadenersatz (Art. 259e OR) bleiben ausdrücklich vorbehalten. Ob eine bauliche Massnahme als zumutbar gilt, ist anhand objektiver Kriterien zu beurteilen. Entscheidend sind unter anderem die Art und Dauer des Mietverhältnisses, der Nutzen der geplanten Änderung, eine mögliche Verbindung mit ohnehin anstehenden Unterhaltsarbeiten sowie die finanziellen Auswirkungen für den Mieter. Unzumutbar sind zum Beispiel Modernisierungen mit enormen Belastungen durch Bauarbeiten, Grundrissveränderungen oder luxuriöse bauliche Massnahmen. Solche Eingriffe stellen das Vertragsgefüge in grundsätzlicher Weise in Frage, einerseits durch massive Einschränkungen des Gebrauchsrechts und anderseits durch aufgedrängte teure Mehrleistungen.
Im Gegensatz dazu darf der Mieter nach Art. 260a OR Erneuerungen oder bauliche Veränderungen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters vornehmen. Ohne diese Zustimmung handelt es sich in der Regel um eine unzulässige Veränderung, die der Vermieter rückgängig machen lassen kann.
Wurde die Zustimmung erteilt, so kann der Vermieter die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands bei Beendigung des Mietverhältnisses nur dann verlangen, wenn dies ebenfalls schriftlich vereinbart wurde. Zeigt sich bei der Rückgabe der Mietsache ein erheblicher Mehrwert infolge der vorgenommenen Massnahmen, hat der Mieter Anspruch auf eine angemessene Entschädigung – vorbehaltlich weitergehender, schriftlich vereinbarter Regelungen.
Während der Vermieter Änderungen und Erneuerungen gemäss Art. 260 OR grundsätzlich ohne Zustimmung des Mieters und gegen seinen Willen vornehmen darf, sind dem Mieter solche Arbeiten untersagt, wenn der Vermieter den Arbeiten nicht schriftlich zugestimmt hat (art. 260a Abs. 1 OR). Eine unbewilligte Änderung an der Mietsache durch den Mieter stellt diesfalls eine Vertragsverletzung dar und bringt grundsätzlich die Wiederherstellungspflicht nach Art. 267 OR mit sich. Für eine Veränderung braucht es gemäss Gesetzeswortlaut die schriftliche Einwilligung des Vermieters. Das Erfordernis der Schriftlichkeit dient der Rechtssicherheit und der Beweiserleichterung.
Es stellt sich nun die Frage, ob und in welchem Umfang ein Mieter für die von ihm vorgenommenen Investitionen in das Mietobjekt einen Anspruch auf eine Mehrwertentschädigung hat. Die Rechtslage ist dabei differenziert zu betrachten und erfordert stets eine Einzelfallbeurteilung.
Ein Anspruch auf eine Mehrwertentschädigung entsteht grundsätzlich erst mit Beendigung des Mietverhältnisses und wird auch erst auf diesen Zeitpunkt hin fällig. Die Entschädigung bemisst sich nach dem objektiven Mehrwert, der insbesondere anhand des Restwerts der Aufwendungen des Mieters sowie der Nützlichkeit der Installationen für den Vermieter zu bestimmen ist. Zentral ist dabei die Frage der Erheblichkeit, wie sie auch im Gesetzestext vorkommt: Es kommt darauf an, ob der Gebrauchswert der Sache infolge der Investitionen des Mieters bei Rückgabe des Mietobjekts erheblich gesteigert erscheint. Die Bemessung erfolgt gemäss Bundesgerichtspraxis nach den Grundsätzen von Treu und Glauben und ist unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände nach Billigkeit (Art. 4 ZGB) vorzunehmen. Dabei wird teilweise diskutiert, ob eine allfällige Mietzinsersparnis, die der Mieter während der Vertragsdauer genossen hat, berücksichtigt werden sollte – insbesondere in Fällen, in denen der Vermieter die Verbesserungen nicht selbst vorgenommen und damit nicht im Mietzins eingepreist hat. Es gilt aber auch der Grundsatz, dass der Vermieter nicht einseitig vom durch den Mieter geschaffenen Mehrwert profitieren soll, insbesondere dann nicht, wenn er das Mietverhältnis selbst gekündigt hat (vgl. BSK OR I-Weber, Art. 260a N 5 f.).
In der Lehre wird kontrovers diskutiert, ob luxuriöse Massnahmen – so etwa der Einbau einer Luxusküche – immer zu einem erheblichen Mehrwert führen. Entscheidend ist, ob diese Massnahmen im Gesamtkontext des Objekts tatsächlich eine höhere Vermietbarkeit oder einen entsprechenden Marktwertzuwachs bewirken. In einer luxuriösen Wohnung kann dies zutreffen, in einem stark abgewohnten Altbau hingegen kaum (SVIT-Kommentar/Bättig N 90 zu Art. 260a OR).
Die Rechtsprechung anerkennt ein weites Ermessen der Gerichte bei der Bemessung der Entschädigung. Ob dabei die sogenannte Sachwertmethode (Wiederbeschaffungswert abzüglich Abnützung) oder die Ertragswertmethode (Zusätzliche Mietzinseinnahmen) zur Anwendung kommt, ist nicht abschliessend geklärt. Das Bundesgericht hat in verschiedenen Urteilen offengelassen, welche Methode die richtige sei (u.a. Urteil 4A_678/2014 vom 27.3.2015). Klar ist jedoch, dass die dem Mieter entstandenen Investitionskosten nicht direkt entschädigt werden können, sondern lediglich als Ausgangspunkt und Obergrenze für die Bestimmung des objektiven Mehrwerts herangezogen werden dürfen (SVIT-Kommentar/Bättig N 94 zu Art. 260a OR).
Einige Stimmen in der Lehre vertreten die Auffassung, ein erheblicher Mehrwert liege erst dann vor, wenn dieser mindestens 10 % des Liegenschaftswerts beträgt. Diese Ansicht wird jedoch als zu schematisch kritisiert. Auch hier zeigt sich: Starre Schwellenwerte sind kaum geeignet, den konkreten Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden (vgl. Mietrecht für die Praxis/Wyttenbach, 10. Auflage, Zürich 2022).
Fazit:
Die Beurteilung einer Mehrwertentschädigung bei Mietende orientiert sich nicht an fixen Zahlen, sondern erfolgt individuell und unter Würdigung sämtlicher relevanter Faktoren. Massgeblich ist der objektiv messbare Mehrwert, den die Investitionen des Mieters zum Zeitpunkt der Rückgabe für das Mietobjekt darstellen. Die Gerichte verfügen bei der Bemessung über einen grossen Ermessensspielraum, wobei sie zwischen der Sachwert- und Ertragswertmethode wählen können. Entscheidend bleibt: Die Entschädigung erfolgt nicht für die getätigten Ausgaben an sich, sondern für den durch sie geschaffenen, über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden Mehrwert – immer unter dem Gesichtspunkt von Recht und Billigkeit.
Angesichts der oftmals komplexen Bewertung eines durch bauliche Veränderungen geschaffenen Mehrwerts an der Mietsache empfiehlt es sich, die Frage einer allfälligen Mehrwertentschädigung sowie die Berechnung bereits im Vorfeld geplanter Umbauten vertraglich zu regeln. Dies kann im Rahmen einer schriftlichen Zustimmungsvereinbarung zwischen Vermieter und Mieter erfolgen. Eine solche Regelung schafft klare Verhältnisse und ermöglicht es, eine etwaige Entschädigungspflicht ausdrücklich wegzubedingen. Auf diese Weise wird die rechtliche Situation für beide Parteien vereinfacht und potenziellen Streitigkeiten wirksam vorgebeugt.
Mögliche Formulierungen könnten lauten (aus SVIT-Kommentar/Bättig N 110 zu Art. 260a OR):
Dem Mieter werden folgende Veränderungen/Bauarbeiten bewilligt: … (Aufzählung).
- Der Mieter verpflichtet sich, auf den Zeitpunkt (ordentliche oder ausserordentliche) der Vertragsbeendigung den ursprünglichen Zustand auf Verlangen des Vermieters fachmännisch wiederherzustellen oder die Mieterausbauten teilweise zu entfernen.
- Dem Vermieter steht das Recht zu, auf den Rückbau ganz oder teilweise zu verzichten. In diesem Fall darf der Mieter bei (ordentlichem oder ausserordentlichem) Vertragsende die Ein- und Ausbauten ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Vermieters nicht entfernen. Gleichzeitigt verzichtet der Mieter auf jegliche Ansprüche auf Entschädigung eines allenfalls geschaffenen Mehrwerts.
- Der Vermieter verpflichtet sich, bei (ordentlicher) Beendigung des Mietvertrages eine Mehrwertentschädigung im Sinne von Art. 260a Abs. 3 OR zu leisten. Diese beträgt maximal … CHF und vermindert sich pro angebrochenes Jahr, berechnet ab Mietbeginn, bis zur (ordentlichen) Beendigung des Mietvertrages um jeweils 10 % p.a.
Gesetzliche Grundlagen:
Art. 260
1 Der Vermieter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache nur vornehmen, wenn sie für den Mieter zumutbar sind und wenn das Mietverhältnis nicht gekündigt ist.
2 Der Vermieter muss bei der Ausführung der Arbeiten auf die Interessen des Mieters Rücksicht nehmen; allfällige Ansprüche des Mieters auf Herabsetzung des Mietzinses (Art. 259d) und auf Schadenersatz (Art. 259e) bleiben vorbehalten.
Art. 260a
1 Der Mieter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache nur vornehmen, wenn der Vermieter schriftlich zugestimmt hat.
2 Hat der Vermieter zugestimmt, so kann er die Wiederherstellung des früheren Zustandes nur verlangen, wenn dies schriftlich vereinbart worden ist.
3 Weist die Sache bei Beendigung des Mietverhältnisses dank der Erneuerung oder Änderung, welcher der Vermieter zugestimmt hat, einen erheblichen Mehrwert auf, so kann der Mieter dafür eine entsprechende Entschädigung verlangen; weitergehende schriftlich vereinbarte Entschädigungsansprüche bleiben vorbehalten.
Autorin: Anina Iff, Substitutin